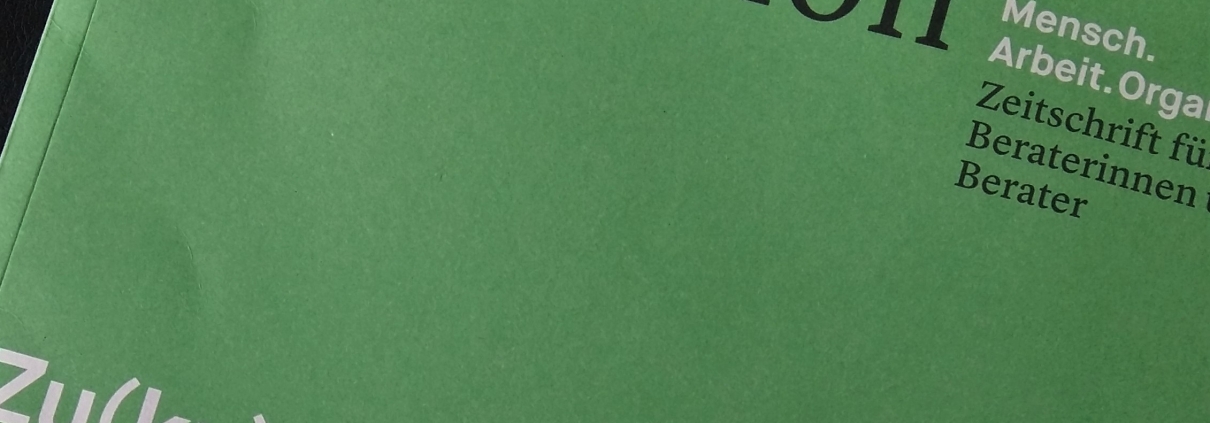mindshakes – der Blog
Wir freuen uns über Kommentare, bitten aber um Verständnis, dass wir diese vor Veröffentlichung redaktionell prüfen.
Blog-Abo
Hier können Sie sich anmelden, wenn Sie über aktuelle Beiträge informiert werden möchten.
Vielleicht gelingt es uns nach den Erfahrungen des Jahres 2020 ja eine Lehre zu ziehen: Der vulgäre Freiheitsbegriff der vergangenen drei Jahrzehnte sollte endlich ausgedient haben. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion proklamierte Francis Fukuyama das „Ende der Geschichte“. Gemeint war, dass der wettbewerbsorientierte Kapitalismus als siegreiche Gesellschaftsform übrig geblieben war und damit das Gesellschaftmodell der Zukunft ein für allemal feststand. Dieses Gesellschaftsmodell setzt vor allem auf die Individualität und Freiheit des Einzelnen, auf dass sich die besten Ideen im Wettbewerb durchsetzen und am Ende alle davon profitieren. An sich keine schlechte Idee – ich bin Selbstständiger und ich schätze Autonomie und Freiheit sehr. Doch wie immer im Leben, wenn man anfängt, etwas zu übertreiben, geht es schief.
Die Übertreibung liegt hier im allzu vulgären Umgang mit der Idee der Freiheit: Nach den Prinzipien „Jeder ist seines Glückes Schmied“, „Der Staat soll sich möglichst aus allem heraushalten“ und „Der Markt wird es schon richten“ wurden immer mehr gesellschaftliche Bereich dem „freien Spiel der Kräfte“ überlassen. Dabei wurde übersehen bzw. billigend in Kauf genommen, dass
- die Schwächeren bei diesem Spiel zwangsläufig den Kürzeren ziehen (die Ungleichverteilung von Vermögen und Einkommen hat dramatisch zugenommen),
- im ständigen (internationalen) Wettbewerb der Druck auf den einzelnen Marktteilnehmer (Individuen, Unternehmen, ganze Staaten) zu zunehmender (Selbst-)Ausbeutung und Externalisierung von Kosten (v.a. Umweltzerstörung, soziale Sicherheit) führt
- und dass schließlich sogar nach und nach die Vorstellung abhanden kam, dass man an diesen zerstörerischen Nebenwirkungen überhaupt irgend etwas ändern könnte.
Besonders deutlich zeigt sich dies gegenüber der Herausforderung des Klimawandels. Angesichts der Größenordnung des Problems ist der Einzelne kaum oder gar nicht in der Lage, einen messbaren Beitrag zu leisten. Dennoch lautet die Argumentation oft: Wenn die Konsumenten nur begönnen, umweltbewusster zu konsumieren, dann würden sich die Unternehmen entsprechend umstellen. Wehe dem, der diese Konsumfreiheit regulieren will (Stichwort: Veggie-Day). Die Verantwortung für die Veränderung wird an das freie Individuum delegiert, das damit jedoch völlig überfordert ist.
Corona hat uns nun jedoch gelehrt, dass es angesichts von Herausforderungen, die vom freien Spiel der Kräfte schlicht nicht zu bewältigen sind, eines starken Staates bedarf, der reguliert und eingreift – und der dafür auch mehrheitlich Zustimmung aus der Bevölkerung erfährt. An diese Stelle gehört vermutlich der Hinweis, dass der Staat ja auch gar nichts anderes als die verfassungsmäßig organisierte Bevölkerung ist. Ein starker Staat ist keineswegs automatisch ein tyrannischer, diktatorischer Staat. Selbstverständlich meine ich mit starkem Staat eine demokratisch verfasste Gesellschaftsform.
Im Grunde haben wir es hier mit einem uralten Problem im Spannungsverhältnis zwischen Kollektiv und Individuum zu tun, das der Ökonom John Maynard Keynes vor rund 100 Jahren schon einmal treffend auf den Punkt gebracht hat: „Die wichtigsten Agenden des Staates betreffen nicht die Tätigkeiten, die bereits von Privatpersonen geleistet werden, sondern jene Funktionen, jene Entscheidungen, die niemand trifft, wenn der Staat sie nicht trifft.“ (aus John Maynard Keynes: Das Ende des Laissez-Faire). Die Entscheidungen, die niemand trifft, wenn der Staat sie nicht trifft. In der Corona-Krise haben Politikerinnen und Politiker glücklicherweise eine Reihe solcher Entscheidungen im Auftrag der Bevölkerung getroffen. Sie haben den Mut dafür aufgebracht – und wurden mit hohen Zustimmungswerten belohnt. Die Entscheidungen, die niemand trifft, wenn der Staat sie nicht trifft. Angesichts des Klimawandels stehen eine Menge solcher Entscheidungen noch aus. Da würde ich mir eine Rückkehr des starken Staates wünschen.
Ich glaube sogar, dass es unserer Seele guttun würde, wenn wir uns als Kollektiv dabei endlich handlungsfähig erleben könnten.
Das Wort Querdenker habe ich noch nie gemocht. Heute weiß ich auch, warum. Wenn sich früher – also vor Corona – Menschen als Querdenker bezeichnet haben, schien mir das immer schon eine Phrase zu sein. Ich verbinde damit die Vorstellung, dass ein Querdenker für sich in Anspruch nimmt, stets eine originelle, von der Mehrheit abweichende Position zu vertreten. Eine andere Meinung zu haben als andere, ist aber kein Wert an sich. Es ist nicht einmal ein Wert an sich, überhaupt zu allem eine eigene Meinung zu haben.
Unsere Welt ist viel zu komplex, als dass jede und jeder über alles Bescheid wissen könnte. Unsere Welt ist glücklicherweise funktional differenziert, so dass wir über Expertenwissen verfügen können, auch wenn wir das nicht immer alles selbst nachvollziehen können. Ich persönlich will das auch gar nicht. Mein Leben wäre viel zu anstrengend, wenn ich mein Handy nicht nur benutzen, sondern auch verstehen wollte. Oder meinen Kühlschrank. Oder die exakte Wirkungsweise von Medikamenten, die ich einnehme. Ich entscheide mich sehr oft bewusst und noch viel öfter sicher unbewusst, darauf zu vertrauen, dass andere das schon richtig machen. Manchmal scheint es allerdings so, als sei dies für einige Menschen eine kaum aushaltbare Kränkung: nicht überall mitreden zu können.
Statt quer zu denken, würde es mir schon genügen, wenn wir einfach nur denken. Es schadet sicher auch nicht, dabei einigermaßen methodisch vorzugehen. Dialektisch z.B.: These – Antithese – Synthese. Da ist das Querdenken ja quasi schon inbegriffen, ohne dass es zum individualistischen Ideal oder zum Ausdruck intellektueller Unabhängigkeit hochstilisiert werden müsste.
Kompromisse sind langweilig. Sie kommen oft nach langen, zähen Verhandlungen zustande. Oft erkennen die Beteiligten ihre Ausgangspositionen nur noch schemenhaft wieder. Auf dem Weg dorthin geht der Feuereifer verloren, mit dem man sein ursprüngliches Ziel einmal verfolgt hat. Kompromisse fordern Perspektivwechsel ab: Was von der Gegenposition kann ich annehmen? Was nachvollziehen? Und am Ende soll man ein solches Verhandlungsergebnis auch noch verteidigen. Eine ganz schöne Zumutung.
Aber Kompromisse sind großartig. Sie halten eine Gesellschaft zusammen. Sie machen das Zusammenleben überhaupt erst möglich.
In normalen Zeiten scheint unsere Gesellschaft mit dieser Zumutung ganz gut umgehen gelernt zu haben. Vermutlich auch deshalb, weil jeder* sich in einer offenen und freien Gesellschaft notfalls seine kleine Nische schaffen kann, in der er kompromisslos sein Ding machen kann. Nun scheinen wir aber auf einen herausfordernden Monat November und vermutlich auf einen anstrengenden Winter zuzusteuern. Und dummerweise ist die Bekämpfung der Pandemie keine Privatangelegenheit. Sie verlangt die Fähigkeit zum Kompromiss.
Make Kompromissbereitschaft great again.
*Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichte ich hier auf gendergerechte Sprache. Ich bitte die geneigte Leserschaft auch in diesem Fall um Kompromissbereitschaft.
Krisen- und Konfliktmanagement, die Frage nach Entwicklungsmöglichkeiten oder einfach nur der Wunsch nach einem unabhängigen Feedback – es gibt mehrere Gründe, warum viele im Berufsleben auf ein begleitendes Coaching setzen. Doch der Coachingmarkt ist unübersichtlich und die Berufsbezeichnung nicht geschützt. Daher gilt: Augen auf bei der Coachauswahl. Aber was macht einen guten Coach aus?
Die Deutsche Gesellschaft für Supervision und Coaching (DGSv) hat hierzu im Sommer eine Radiokampagne durchgeführt. Unter dem Titel „Gute Beratung! Supervision und Coaching im Beruf“ lief die Produktion auf Sendern wie dem Berliner Rundfunk, Radio Frankfurt, verschiedenen Antenne-Sendern, Radio SAW u.v.m.
Im November 2019, lange vor Corona, in einer versunkenen Zeit, hatte die Redaktion der Zeitschrift „Supervision“ einige Supervisor/innen und Coaches zu einem Brainstorming eingeladen. Ziel war es, eine Ausgabe der Zeitschrift zu den Zukunftsperspektiven der Supervision vorzubereiten. Diese Ausgabe ist nun, im Juli 2020, erschienen, mit einem Beitrag von Robert Erlinghagen über „Die ungewisse, aber goldene Zukunft der Supervision“.
Bemerkenswerterweise sind die Beiträge allesamt weiterhin aktuell, obwohl sich doch scheinbar durch Corona so vieles geändert hat. Vielleicht sind sie sogar aktueller, als vor der Pandemie – denn
- erstens sind Supervision und Coaching ja diejenigen Professionen, die ein Innehalten im Berufsalltag ermöglichen – also im Kern genau solche Phasen begleiten, wie wir sie als Gesellschaft derzeit erleben und
- zweitens stehen Supervision und Coaching für einen professionellen Umgang mit Mehrdeutigkeit, Ungewissheit, unterschiedlichen Perspektiven und ergebnisoffenen Prozessen der Kommunikation über und Organisation von Arbeit. Und Ungewissheit ist ja so etwas wie der Markenkern der Corona-Pandemie.
Genau deshalb ist die Zukunft dieser Professionen auch golden: Weil der Bedarf an Nachdenklichkeit, an der Fähigkeit mit Ungewissheit und Widersprüchlichkeit im Berufsleben umgehen zu können, tendenziell zunehmen wird – Corona hin oder her. Darüber hinaus wächst – wie der Soziologe Hartmut Rosa veranschaulicht – das Bedürfnis nach Resonanz. Supervisor/innen und Coaches sind Profis darin, genau dies zu ermöglichen, während sie gleichzeitig die ökonomische Anforderung der Effektivität beruflichen Handelns nicht aus dem Blick verlieren. Supervisor/innen und Coaches arbeiten systematisch mit den unterschiedlichsten antagonistischen Prozessen, wie sie sich in der Corona-Krise noch einmal zugespitzt haben.
Ungewiss ist die Zukunft sowieso immer. Im speziellen Fall der Entwicklungsperspektiven für Supervision und Coaching ist sie deshalb besonders ungewiss, weil die Anforderungen an die Professionen steigen. Das Fazit des Beitrags zur goldenen, aber ungewissen Zukunft lautet: Coaches und Supervisor/innen benötigen nicht nur die oft beschworene Methodenvielfalt. Sie benötigen auch eine Welterklärungsvielfalt – also viele verschiedene Ansätze, die Arbeitswelt zu verstehen. Auch dies hat sich in der Corona-Krise noch einmal verdeutlicht: Es ist gar nicht so leicht, unterschiedliche Denksysteme (hier: Virologie, Ökonomie, Politik, Psychologie, Medien usw.) miteinander in ein konstruktives Gespräch zu bringen. Selbst wenn man glaubt, sich verstanden zu haben, führen die inneren Logiken der unterschiedlichen Denkschulen fast unweigerlich zu Missverständnissen, Fehlinterpretationen und in der Folge zu wechselseitiger Kritik bis hin zu Schuldzuweisungen oder gar Verschwörungsmythen. Auch dies ist eine Kernkompetenz von Coaches und Supervisor/innen: Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven, Biografien, inneren Landkarten ins Gespräch zu bringen – und nicht zu früh mit dem Nachfragen aufzuhören.
Allerdings: Sind Coaches und Supervisor/innen z.B. selbst ausreichend in der Lage, die Komplexität z.B. der Digitalisierung zu reflektieren? Sind sie in der Lage, den gap zwischen digital natives und digital immigrants auch in den eigenen Reihen zu überwinden? Sind sie bereit, sich aus den verschiedensten Quellen (Psychologie, Soziologie, Ökonomie, …) inspirieren zu lassen, um auf der Höhe der Zeit zu bleiben? Wird es ihnen gelingen, den Nutzen ihrer Fähigkeit im Umgang mit Ambiguitäten und Ungewissheiten nachvollziehbar zu vermitteln?

 Bild von Andrzej Rembowski auf Pixabay
Bild von Andrzej Rembowski auf Pixabay