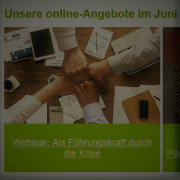„Krise als Chance“ – das ist eine gern genutzte Floskel in diesen Tagen. Und tatsächlich stimmt es ja auch, dass in krisenhaften Situationen plötzlich Dinge möglich sind, die zuvor undenkbar schienen. Dazu ist schon viel geschrieben worden, auch in diesem Blog („Krise als Chance“ und „Nachdenken über Corona VIII“).
Seit ein paar Tagen beschäftigt mich zunehmend die Frage, was denn die Bedingungen sind, damit Chancen auch ergriffen werden können. Hierzu hat der Soziologe Armin Nassehi nun am 4.5.20 auf Zeit Online einen erhellenden Beitrag veröffentlicht: „Das Virus ändert alles, aber es ändert sich nichts.“ Seine Kernthese:
„Das Virus hat tatsächlich alles verändert, aber es hat sich nicht das Geringste daran geändert, wie eine komplexe Gesellschaft auf solch eine Ausnahmesituation reagiert. Man könnte sagen: Sie tut es ziemlich routiniert. Wir sehen, dass alle Akteure genauso auftreten, wie sie es sonst auch tun.
Natürlich ist es Wirtschaftsverbänden ein Anliegen, endlich wieder die Wertschöpfungsketten zu schließen und die katastrophalen ökonomischen Folgen abzumildern, was sollen sie sonst fordern? Natürlich haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein existenzielles Interesse daran, dass ihre Arbeitsplätze erhalten bleiben. Selbstverständlich machen sich Juristen und Gerichte Gedanken über die Rechtmäßigkeit von Maßnahmen. Und selbstverständlich wird die Berichterstattung in den Medien nun vielstimmiger und kritischer den Maßnahmen gegenüber. Und selbstverständlich mehren sich die Stimmen aus dem psychosozialen, dem pädagogischen und dem therapeutischen Bereich, welche unglaublichen Folgen der Lockdown für Familien, für Kinder und Jugendliche, für Partnerschaften, für Geschlechterverhältnisse, für ohnehin prekäre Lebenslagen und für das Gewaltniveau in Nahbereichen haben. Alle Akteure spielen die Rollen, die sie immer gespielt haben. Das ist freilich kein Vorwurf, sondern bildet letztlich die Struktur der Gesellschaft ab, die so mit den ihr eigenen Mitteln reagiert.“
(Armin Nassehi)
Dieser Effekt hat zumindest kurzfristig sogar erhebliche Vorteile, er stellt die Leistungs- und Handlungsfähigkeit der Gesellschaft als Ganzes und der verschiedenen Teilsysteme unter Beweis, die diese Krise bislang erstaunlich unaufgeregt verdauen. Trotz allen Murrens, aller Demos und aller Verschwörungstheorien: Von einem wirklichen Ausnahmezustand sind wir weit entfernt.
Allerdings zeigt sich auch:
„Viele Wirtschaftsstrukturen halten augenscheinlich die lange Unterbrechung kaum aus. Familien geraten schnell in Ausnahmezustände, für Kinder und Jugendliche ist der Kontakt nach außen vielleicht wichtiger als der zu den Familienmitgliedern. Und die Bespielung moderner nervöser Seelen braucht offensichtlich mehr Abwechslung, als derzeit trotz Streamingdiensten und gelieferten Konsumartikeln zur Verfügung steht.
Man kann an diesen Krisenfolgen sehr deutlich sehen, wie fragil diese so stabile Gesellschaft immer schon war und wie sehr sie auf Kante genäht ist: Sie scheint in ihrer dynamischen Stabilität davon abhängig zu sein, dass es weitergeht wie bisher. Nicht weil sie so stabil ist, ist es schwer in die Dynamik der Gesellschaft einzugreifen, sondern weil diese Stabilität so sehr von sensiblen Konstellationen abhängig ist.“
(Armin Nassehi)
Der routinierte Umgang mit der Krise beschränkt enorm das tatsächlich disruptive, innovative, schöpferische Potenzial. Mehr als Verdauen scheint nicht drin zu sein. Die Angst vor dem Verlust des Status Quo ante, vor der Krise, scheint zu groß zu sein. So haben schon die Verhaltensökonomen um Daniel Kahnemann festgestellt, dass Menschen mehr Energie aufbringen, um einen Verlust zu vermeiden, als einen Gewinn zu erzielen, dass sie größere Risiken eingehen, um den Status quo zu erhalten, als dass sie ihn ändern.
Diese Beobachtung im aktuellen gesellschaftlichen Großexperiment, das wir alle durchleben, sollten sich Führungskräfte ebenso wie Organisationsberater und Coaches als Lehrstück zu Herzen nehmen. Es reicht eben bei weitem nicht aus, die Chance in der Krise bloß zu proklamieren. Der Hoffnung müssen Taten folgen:
- Es braucht einflussreiche Akteure, die zupacken – und dabei bereit sind, ihre angestammten Rollen zu verlassen und etwas wirklich anderes tun.
- Es braucht die Bereitschaft, Verluste tatsächlich abzuschreiben und auf ungewisse Gewinnchancen zu setzen.
- Es braucht eine gemeinsame moderierte ergebnisoffene Reflexion über Auswirkungen und Chancen der Krise.
- Und es braucht möglichst eindeutige und frühzeitige Festlegungen, in welcher Hinsicht man nicht zum Zustand vor der Krise zurückkehren wird.
Nun sind konzertierte Aktionen in offenen, pluralen, demokratischen Gesellschaften schwierig und selten geworden. Fraglich, ob sie überhaupt wünschenswert sind. Nassehi legt Wert darauf, bloß Wirkungsweisen dieser Gesellschaftsform beschreiben zu wollen und auch kein Patentrezept zu haben.
„Einer der schönsten biologischen Sätze zur Pandemie lautet, mit dem Virus könne man nicht verhandeln. Genau genommen gilt dieser Satz auch für die Gesellschaft. Mit ihr kann man auch nicht verhandeln, weil ihre Eigendynamik offensichtlich in einer merkwürdigen Kombination aus Stabilität und Fragilität fast unerreichbar ist. Immerhin kann man in ihr verhandeln.
(Armin Nassehi)
Was bleibt also? Fangen wir an zu verhandeln. Vielleicht nicht so sehr mit Organisationen, sondern in ihnen. Und vielleicht sollten wir dabei öfter einmal zivilisiert aus der Rolle fallen.