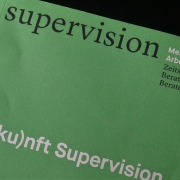Zusammenfassung: Das Bedürfnis nach Sinnstiftung und Authentizität in der Arbeitswelt nimmt zu. Es könnte sein, dass die Ausdifferenzierung unserer Gesellschaft und die damit verbundene Ausdifferenzierung unserer Selbst in viele, allzu viele „Segment-Ichs“ (Theweleit) an einen Punkt gelangt, wo es dem Einzelnen und auch der Gesellschaft nicht mehr ohne Weiteres gelingt, die inneren Spannungszustände zu integrieren. Das wäre einerseits bedrohlich, weil unbewältigte Spannungsverhältnisse wie Sprengstoff auf die Psyche wie die Gesellschaft wirken können. Darin läge aber auch eine echte Chance – etwa für eine sozial-ökologische Transformation und für ein Ende des Beschleunigungs- und Wachstumsmythos.
Zwei Fragen
In meinen Beratungsprozessen und Coachings tauchen zunehmend zwei Fragen auf:
- Wie schaffe ich oder wie schaffen wir es, unserem Handeln einen tieferen Sinn zu geben? Alternativ: Wie schaffen wir es, angesichts von allen möglichen Sachzwängen, den Sinn unseres Handelns nicht aus den Augen zu verlieren?
- Wie gelingt es mir, mich nicht zu verbiegen? Wie kann ich mir selbst treu bleiben? Wie bleibe ich in meinen verschiedenen Rollen und Funktionen authentisch?
Zuerst hatte ich gedacht, dass mir diese Fragen nur deshalb häufiger begegnen, weil sie mich auch selbst umtreiben. Es ist oft so, dass man als Coach genau für solche Klientinnen und Klienten ein guter Sparringspartner ist, die mit ähnlichen inneren Themen beschäftigt sind. Darüber hinaus dachte ich auch, dass diese Fragen, die potenziell für jeden eine Herausforderung darstellen, gewissermaßen eine antropologische Konstante sind. Fragen also, die sich die Menschen immer schon und über alle Kulturen hinweg gleichermaßen gestellt haben.
Transformation der Gesellschaft und Modernisierung der Seele
Wenn man sich allerdings die Ratgeber- und Managementliteratur anschaut, dann scheint dieses Bedürfnis nicht nur ausgerechnet in meinen Beratungsprozessen an Bedeutung zu gewinnen. Es scheint ein sich ausbreitendes Phänomen in der Arbeitswelt zu sein. Paradebeispiel ist sicher das Werk von Frederic Laloux „Reinventing Organizations: Ein Leitfaden zur Gestaltung sinnstiftender Formen der Zusammenarbeit“, das seit seinem Erscheinen im Jahr 2014 Furore macht, inzwischen über 600.000 mal verkauft wurde und eine Welle von Fach- und Ratgeberliteratur nach sich zog, die allesamt die Vorteile von Sinnstiftung und Authenizität in der Arbeitswelt ausarbeiten oder gar anpreisen. Doch die Vorteile und Auswirkungen von Sinnstiftung und Authentizität werden dabei eher schlicht proklamiert und wenig hinterfragt: Für den Menschen an sich ist es halt besser, gesünder, und für die Unternehmen ist es ein Wettbewerbsvorteil, wenn die Mitarbeiter*innen zufrieden sind. Die Ursachen für die zeitgenössische Suche nach Sinn werden weniger reflektiert.
Zur dieser Art von Sinnstiftung und Authentizitätsversprechen habe ich ein ambivalentes Verhältnis (ausführlich dargestellt in Robert Erlinghagen/Rainer Witzel: Jetzt seid Ihr dran. Über Agilität, in: Positionen 1 (2019)). Denn der Schritt von der gemeinschaftlichen Sinnstiftung zum Fundamentalismus und der Schritt von der Forderung nach Authentizität zur Kompromisslosigkeit ist manchmal nicht allzu weit.
Nun habe ich in den vergangenen Monaten einige Autoren gefunden, die diese Fragen noch einmal in ein ganz anderes Licht rücken: Klaus Theweleit, Armin Nassehi, Martin Dornes und Martin Altmeyer.
Theweleit spannt einen weiten Bogen vom 15. Jahrhundert bis in die Gegenwart, in dem er beschreibt, wie die Verwissenschaftlichung der Welt vor allem durch die Methoden der Segmentierung und Sequenzierung sich tief in unsere Psyche eingegraben hat. Segmentierung bedeutet Aufteilung, Aufspaltung, Zergliederung. Sequenzierung ist die Erstellung einer Abfolge. Segmentierung und Sequenzierung sind Voraussetzungen für Empirie und moderne wissenschaftliche Erkenntnis sowie für ökonomische Rationalisierung und Standardisierung. Sie schaffen zugleich die Voraussetzungen für die Wachstumsdynamik und die Beschleunigung ökonomischer und sozialer Prozesse. Ohne Segmentierung – also z.B. die Unterscheidung einzelner Produktionsschritte – und anschließende Sequenzierung – also z.B. die Aneinanderreihung und Vervielfältigung dieser Produktionschritte – gäbe es keine moderne Industrieproduktion. Segmentierung und Sequenzierung sind also Grundpfeiler für den ökonomischen Erfolg, den Wohlstand, den inzwischen erreichten Lebensstandard in modernen Gesellschaften. Sie sind aber – wie Theweleit anschaulich darlegt, ebenso Grundmuster all der Schattenseiten dieser Erfolgsgeschichte: Kolonialisierung, Rassismus, Ausbeutung, Umweltzerstörung… alles Formen von Abspaltungen, Segmentierungen.
Ihren vorläufigen Endpunkt finden Segmentierung und Sequenzierung in der Digitalisierung, d.h. der Fähigkeit fast die ganze Welt in Abfolgen von 0 und 1 zu zerlegen und in verschiedensten Kombinationen aneinanderzufügen. Armin Nassehi arbeitet heraus, dass gerade die Vereinfachung der Grundstruktur für Segmentierung auf 0/1 eine unbegrenzte Ausdifferenzierung in der Sequenzierung ermöglicht. Zum Verständnis hilft möglicherweise der Vergleich mit der Entwicklung der Schrift: Begonnen hat es mit Bildsymbolik (Höhlenmalerei), die zunächst wenig Variantionen ermöglichte: Ein Bild eines Jägers war das Bild eines Jägers. Es folgten Zeichensymbole wie die Hieroglyphen oder die chinesischen Schriftszeichen, die mehr Variationsmöglichkeiten boten, aber mit ihrer Vielzahl an Zeichen vergleichsweise kompliziert zu nutzen und gleichzeitig immer noch eingeschränkt blieben. Die Zeichen selbst blieben festgelegt auf einen gewissen symbolischen Gehalt. Schließlich setzte sich das Alphabet durch: Kaum mehr als zwanzig Zeichen, die selbst keinen symbolischen Inhalt mehr haben, aber sich zu allen möglichen Lautfolgen, kombinieren lassen. Reduzierung der Grundstruktur bei gleichzeitiger Erhöhung der Variabilität und Komplexität. Segmentierung und Sequenzierung als Voraussetzung für quasi unendliches Wachstum.
Segment-Ich
Zunehmende Segmentierung finden wir also als basales Phänomen in der Gesellschaft – aber eben auch in der menschlichen Psyche. Der Vorstellung eines konsistenten Ich, das immer weitestgehend ähnlich tickt und zur Not die schlecht integrierbaren Anteile oder Erfahrungen abspaltet, setzt Theweleit das Konzept eines Segment-Ich entgegen. Dieses Segment-Ich kann „vom Frühstückstisch die Kinder freundlich auf den Schulweg bringen, (Ehe)Partner mit Kuss veraschieden, auf dem Weg zur Arbeit Date mit Liebespartner vereinbaren, um 10:00 h im Büro ein Aktiengeschäft tätigen, das seine Rendite u.a. über Waffenproduktionen einfährt; um 10:50 h für hungernde Kinder in Indien spenden sowie für eine Institution, die sich um Kindersoldaten im Kongo kümmert; um 11:30 h einen Untergebenen zur Sau machen wegen lascher Arbeitsauffassung; in der Mittagspause nett zu allen Mitessern sein (für deren Entlassung er in der Sitzung um 14:30 h plädiert, da notwendig im Sinne der Firma); zwischendrin das Blatt lesen, das alle Kriege und soziale Ungerechtigkeiten geißelt“ usw. usf. (Theweleit 2020, S. 350). Das Segment-Ich tut lauter Dinge, die zusammen gedacht höchst widersprüchlich erscheinen. Es ist Virtuose im umschalten, im segmentieren von kognitiven Dissonanzen. Dabei ist es sich dieser verschiedenen Ich-Zustände durchaus bewusst und kann sie an- und abschalten. Nichts wird abgespalten oder verdrängt. Zustände werden aneinander gereiht.
Ähnliches formuliert Martin Dornes. Er hat eine Überblicksdarstellung über vielfältige Studien zu Veränderungen psychischer Grundstrukturen verfasst und kommt zu dem Schluss: „Die psychischen Instanzen von Es, Ich und Über-Ich sind weniger gegeneinander abgeschottet als früher, der Charakter ist weniger starr, aber unter bestimmten Umständen auch weniger belastbar, die Verdrängungen sind reversibler und weniger endgültig.“ (Dornes 2012, S. 349) Mit anderen Worten: der gesellschaftliche Strukturwandel schlägt sich in einem Sozialcharakter nieder, der den modernen Anforderungen an Flexbilität besser enstpricht als beispielsweise der „autoritäre Charakter“ vergangener Jahrzehnte. Die ständige Anpassungsleistung an wechselnde Kontexte führt gleichzeitig aber zu einer erhöhten Verletzlichkeit – vor allem, weil das Individuum auf immer wieder neue Resonanz aus den unterschiedlichen Kontexten angewiesen ist und sich darum bemüht, sich diesen Resonanzen entsprechend zu verhalten.
Besonders weit fortgeschritten ist diese Entwicklung nach Martin Altmeyer in den Generationen, die in der digitalen Moderne mit ihrer zusätzlichen Segmentierung in sozialen Netzwerken aufwachsen. Hier kommt zum Segment-Ich noch ein „Hang zur psychischen Exzentrik, die sich in der Lust am Performativen und Selbstdarstellerischen zeigt“ (Altmeyer 2019, S. 810), hinzu. Altmeyer schlägt für diesen Sozialcharakter die Bezeichnung „exzentrisches Selbst“ vor – exzentrisch, weil es „buchstäblich aus sich und seinem inneren Zentrum herausgeht (…): Die exzentrische Persönlichkeit neigt dazu, ihr Innerstes nach außen zu kehren, um der ganzen Welt zu zeigen, wer sie ist, was sie empfindet, wie sie denkt, was sie will und kann. Dabei bemüht sie sich um ein möglichst authentisches Auftreten. Sie versucht sich weder zu verstecken noch zurückzuhalten, sondern ihre wahren Bedürfnisse, Gedanken und Gefühle unverstellt auszudrücken. Im Schlepptau dieses zeittypischen Drangs nach medialer Sichtbarkeit bahnt sich ein Verlangen nach sozialer Resonanz den Weg von innen nach außen, das ebenso zeittypisch ist.“ (Altmeyer 2019, S. 810)
Überdehnung des Segment-Ich?
Folgt man Theweleit, Dornes und Altmeyer, dann ist diese Modernisierung der Seele durch Segmentierung und Flexibilisierung eine natürliche, evolutionäre und – nach Dornes und Altmeyer – geeignete Antwort auf die Anpassungszumutungen moderner Gesellschaften. Dornes und Altmeyer sind deshalb auch optimistisch im Hinblick auf die Zukunft: Sie sehen keine Anzeichen für eine Zunahme psychischer Störungen, sondern im Gegenteil ein wachsende Fähigkeit gerade jüngerer Generationen, mit den Herausforderungen der segmentierten Moderne umzugehen.
Für mich persönlich erscheint das Konzept des Segment-Ich höchst plausibel. Allerdings frage ich mich, ob die Sehnsucht nach Sinnstiftung und Authentizität nicht doch auch als ein Symptom der Überforderung durch Hypersegmentierung gesehen werden kann. Gerade in solchen Momenten, in denen Muße zur Selbstreflexion herrscht (z.B. Coachings oder in corona-bedingten Auszeiten), werden die inneren Spannungen zwischen den Segment-Ichs überdeutlich. Die kognitiven Dissonanzen werden nicht länger segmentiert, sondern zu einem spannungsreichen Gesamtbild gefügt. Wir geraten tatsächlich in massive innere Konflikte à la „Ich weiß um den Klimawandel – und fliege dennoch auf die Malediven“.
Vielleicht erleben wir gerade eine Zeit, in der die Fähigkeit zur psychischen Segmentierung an ihre Grenzen stößt. Das könnte bedrohlich werden, weil unverkraftbare Spannungsverhältnisse wie Sprengstoff auf die Psyche wie die Gesellschaft wirken können. Wir finden zwar immer noch die klassischen unbewussten Verarbeitungsmechanismen wie Verdrängung, Verleugnung, Abspaltung (z.B. bei der Corona-Leugung oder der Leugnung des Klimawandels). Aber wenn sich die Wirklichkeit über das eine oder andere Segment-Ich dann doch ins Bewusstsein schleicht, funktionieren diese unbewussten Abwehrmechanismen nicht mehr. Dann weiß ich, dass ich verdränge – und halte es irgendwann nicht mehr aus.
Darin läge auch eine echte Chance für eine sozial-ökologische Transformation und für ein Ende des Beschleunigungs- und Wachstumsmythos. Denn die Erfahrung zeigt, dass Veränderungen ein gewisses Maß an Leidensdruck und Konfrontation mit unliebsamen Realitäten erfordern. So lange wir kognitive Dissonanzen problemlos aneinanderreihen und soziale und ökologische Fragen immer weiter segmentieren, werden notwendige grundlegende und sinnvoll-integrierende Entscheidungen eher selten bleiben. Vermutlich sind wir erst dann bereit, tiefgreifende Veränderungen einzuleiten, wenn uns diese Segmentierung psychisch nicht mehr gelingt. In jedem Fall braucht es dringend noch mehr gesellschaftlichen Dialog und mehr Muße zur Selbstreflexion, um die Segment-Ichs miteinader ins Gesprch zu bringen und den Sprengstoff zu entschärfen.
Coaching und Supervision sind dafür übrigens sehr geeignete Ansätze.
Literatur
- Altmeyer, Martin (2019) : Auf der Suche nach Resonanz. Entwurf einer Zeitdiagnose der digitalen Moderne, in : Psyche, Heft 9/10 (2019), S. 801-822
- Dornes, Martin: Die Modernisierung der Seele, Frankfurt 2012
- Erlinghagen, Robert/Witzel, Rainer: Jetzt seid Ihr dran. Über Agilität, in: Positionen. Beiträge zur Beratung in der Arbeitswelt 1 (2019)
- Laloux, Frederic: Reinventing Organizations: Ein Leitfaden zur Gestaltung sinnstiftender Formen der Zusammenarbeit, München 2015
- Nassehi, Armin: Muster – Theorie der digitalen Gesellschaft, München 2019
- Theweleit, Klaus: Warum Cortés wirklich siegte. Technologiegeschichte der eurasisch-amerikanischen Kolonialismen. Pocahontas III, Berlin 2020


 Bild von Ich28 auf Pixabay
Bild von Ich28 auf Pixabay Bild von Andrzej Rembowski auf Pixabay
Bild von Andrzej Rembowski auf Pixabay