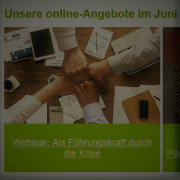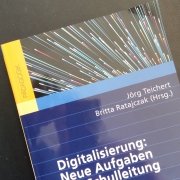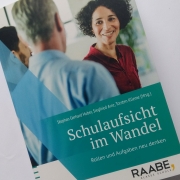Selbstorganisation? Hierarchische Führung? Hmm…
Selbstorganisation ist etwas Großartiges. Als Freiberufler betrachte ich sie schon aus ganz egoistischen Motiven als hohes Gut.
Doch schon lange vor der Corona-Pandemie haben der Kollege Rainer Witzel und ich uns kritisch mit dem Hype um diese Idee auseinander gesetzt, unter anderem mit einem Artikel „Last Exit Selbstorganisation“ sowie einigen Texten über Agilität (in den „Positionen“ sowie im „Coaching-Magaztin„). Selbstorganisation wurde zuletzt fast als Allheilmittel gefeiert: gegen verkrustete Organisationsstrukturen, gegen Frust über Führungshandeln oder als Patentrezept zur Anpassung an verschärften Wettbewerb und die VUKA-Welt. (VUKA steht für: volatil, unsicher, komplex, ambivalent, d.h. für die Vorstellung, dass die Welt auf unterschiedliche Weise immer unübersichtlicher wird.)
Ohne Zweifel kann eine Organisationsentwicklung, die auf Selbstorganisation setzt, nicht nur zweckmäßig sein, sondern auch emanzipatorische Kräfte entfalten. Prinzipiell ist es eine attraktive Vorstellungen, Arbeitsbedingungen zu schaffen, in denen die Menschen so selbstbestimmt wie möglich handeln können.
Doch aktuell sehen wir, wie eigentlich immer wieder im Leben, dass alles seine zwei Seiten hat. Zum Glück und notwendigerweise sind schon immer in Bereichen der Krisenbewältigung die Aufgaben top-down organisiert: Feuerwehr, Notaufnahmen,…. Das fällt einem im Alltag nur nicht so auf. Dezeit allerdings zeigt sich flächendeckend, wie vorteilhaft es sein kann, wenn Entscheidungsketten und Hierarchiestufen klar festgelegt sind und nicht ständig neu verhandelt werden.
Das Wort Selbstorganisation enthält eben auch das Wort Organisation. Und dies beinhaltet, dass viel Zeit und Meta-Kommunikation darauf verwendet wird, wer genau wann wofür die Verantwortung übernimmt. Nur: manchmal hat man diese Zeit und Ruhe eben nicht. Dann ist es gut, wenn jemand Führungsverantwortung übernimmt und top down Entscheidungen trifft, auch wenn sie nicht allen passen.
Die demokratische Verfasstheit unseres Landes ermöglicht es, spätestens im Nachhinein in Ruhe zu prüfen, ob sich die (gewählten) Führungskräfte angemessen und korrekt verhalten haben und ob sie die richtigen Entscheidungen getroffen haben. So ähnlich machen es auch andere Berufsgruppen, z.B. Kriseneinsatzkräfte oder Piloten. Diskutiert und Rechenschaft abgelegt wird im Nachhinein. Bis dahin haben Führungskräfte hier einen Vertrauensvorschuss verdient, so lange sie sich nichts sofort erkennbar Gravierendes zu Schulden kommen lassen.
Platz für Selbstorganisation ist dennoch. Das zeigen all die großen und kleinen Initiativen, die derzeit aus dem Boden sprießen, um kreative Ideen zur Bewältigung des neuen Alltags zu entwickeln und umzusetzen: sei es unter dem Dach des Hackathons „#WirvsVirus“, sei es der lokal organisierte Einkaufsservice z.B. in den Digitalen Dörfern. Selbstorganisation ist hier die Reaktion auf von oben angeordnete restriktive Maßnahmen – und zwar interessanterweise mit dem Ziel, diesen Maßnahmen zum Erfolg zu verhelfen. Nicht subversiv, gegen „die Mächtigen“.
Vielleicht gelingt es uns künftig, die Frage des Verhältnisses zwischen Hierarchie und Selbstorganisation in der Arbeitswelt mit diesen Erfahrungen etwas weniger ideologisch zu beantworten – weder mit dem simplen und gefährlichen Ruf nach „starken Männern“, noch mit einem allzu beliebigen oder verklärten Blick auf Selbstorganisation. Es kommt immer auf den Kontext an.
Bei aller Kritik an Details, an Fehlern der Vergangenheit bei der Organisation des Gesundheitswesens, bei aller Sorge um die wirtschaftliche Zukunft und bei allem Mitgefühl für die unmittelbar Betroffenen: Ich persönlich bin jedenfalls sehr froh zu sehen, wie gut die Institutionen dieses Staates in der Krise bislang funktioneren und wie selbstverständlich die verschiedenen Entscheidungsträger ihre Verantwortung wahrnehmen und bereit sind, schwierige Entscheidungen zu treffen. Respekt.

 Bild von Jónas Thor Björnsson auf Pixabay
Bild von Jónas Thor Björnsson auf Pixabay